Ein Städteführer als Roman - kann das gelingen? Für Brüssel funktioniert das ganz hervorragend. Geschrieben hat das Buch die belgische Schriftstellerin Daphné Tamage, selbst in Brüssel geboren und aufgewachsen. Am Beginn des Romans befindet sich ihr Alter-Ego, die Ich-Erzählerin des Romans, in Italien. Bewusst hat sie Brüssel den Rücken gekehrt. Ihr Verhältnis zu ihrer Heimatstadt ist mindestens zwiegespalten, wenn nicht gar schlecht. Jetzt aber wird sie nach Brüssel zurückgeholt, weil dort ihr künstlerischer Mentor gestorben ist.
Von dieser Rückkehr erzählt der kurze Roman - 24 Stunden in Brüssel. Die Ankunft an einem Abend und dann vor allem der Tag der Trauerfeier, bei dem sich die Protagonistin zu Fuß durch Brüssel bewegt, zeitweise begleitet von einer Brüsseler Freundin und einem Kätzchen. Die Orte, an denen die Protagonistin bei ihrem Streifzug durch Brüssel vorbeikommt, lösen bei ihr Gedanken und Erinnerungen zu ihrer Heimatstadt aus.
"Ich bog in die Königsgalerie - die Galérie du Roi - ein und setzte mich an einen Tisch des Mokafé. Denn das Mokafé war nicht zerstört worden, es hatte überlebt und ich hatte entschieden, in dieser Stadt nur das zu lieben, was nicht abgerissen und neugebaut, oder hinter der Fassade abgerissen worden war. Brüssel, die "Hauptstadt der Fassadenkultur", so hätte die Devise dieser Stadt lauten können." (Seite 26)
In diesem reflektierenden Plauderstil geht es weiter. Der Spaziergang der Protagonistin führt sie über das Zentrum von Brüssel nach Ixelles. Uccle taucht in der Erinnerung an ihre Kindheit auf. Nach einem Abstecher zum Afrika-Museum in Tervuren geht es über die Place Flagey, das Afrika-Viertel, den Justizpalast und die Marollen bis raus nach Molenbeek und letztlich wieder zurück ins Zentrum der Stadt.
Immer, wenn ein neuer Platz auftaucht beziehungsweise einer, der für den Brüssel-Besucher aus Sicht der Autorin interessant scheint, gibt sie diesem Platz Raum im Roman. "Der Justizpalast, entworfen im griechisch-römischen Stil vom Architekten Joseph Poelart, ist ein Mythos für sich. Der Grundstein wurde 1866 gelegt und das Gebäude 1883 eingeweiht. Jahrzehntelang blieb er das größte aus Stein gebaute Gebäude der Welt." (Seite 64)
Dabei sind es meist die eher weniger bekannten Orte von Brüssel, die dem Leser vorgestellt werden. Das Atomium und Manneken Pis zum Beispiel tauchen nur einmal kurz in Halbsätzen auf. Stattdessen entdeckt der Leser Orte wie zum Beispiel das ehemals größte Kino der Stadt, in dem heute das Kleidungsgeschäft Zara untergebracht ist, die frühere Jazz-Kneipe "Blue Note", in der bereits seit Jahren die Buchhandlung "Tropismes" Bücher verkauft. Oder auch das Théatre 140, das Rathaus von Ixelles, die einzige Stelle im Zentrum der Stadt, wo noch ein Teil des Flüsschens Senne offenliegt und nicht überbaut ist.
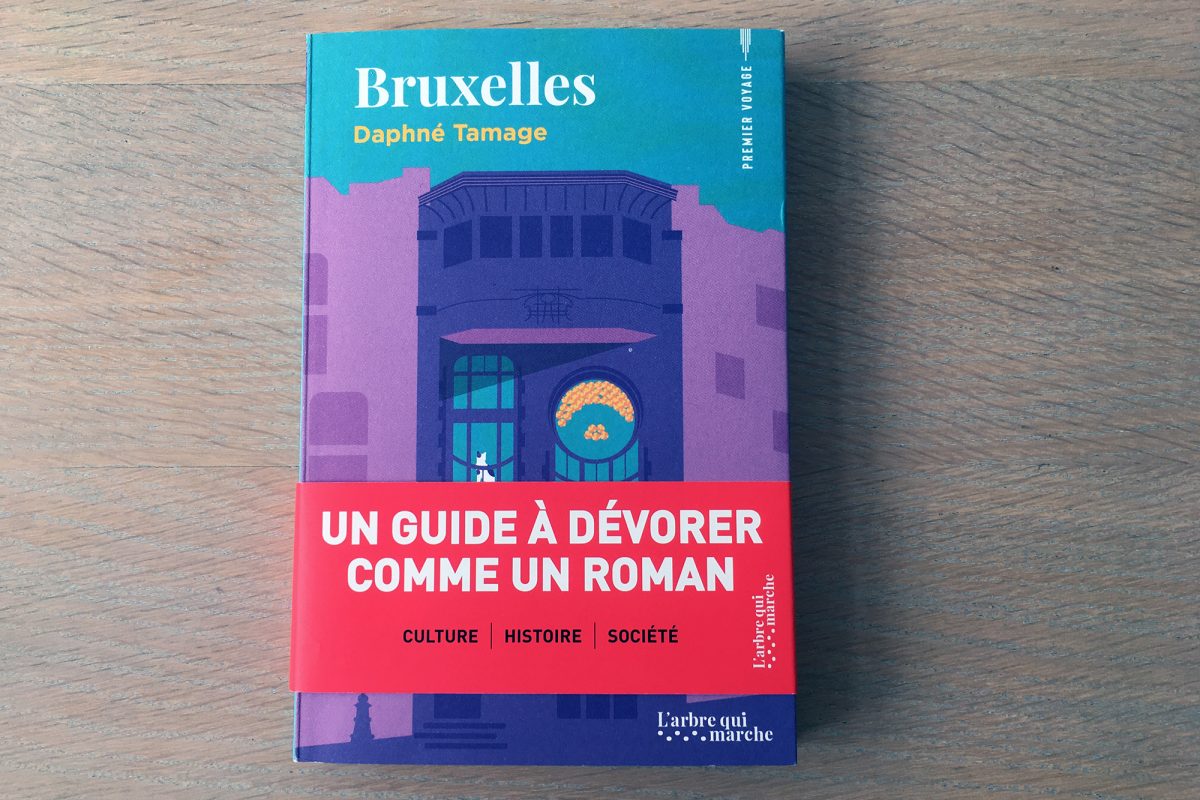
Außerdem tauchen immer wieder die Namen von bekannten Personen und Kindern der Stadt auf, wenn der Spaziergang an Orten vorbeiführt, die mit ihnen in Verbindung stehen. "Das Cirio ist eine Brasserie im Jugendstil, wo Jacques Brel gerne hinging, um mehrere Half-en-Half zu trinken, den Cocktail des Hauses, der halb aus Weißwein, halb aus Schaumwein besteht." (Seite 78)
Apropos Half-en-Half: Den "Brussels vloms", das flämische Brüsslerisch, die Sprache, die die Menschen in Brüssel Jahrhunderte lang gesprochen haben, stellt die Autorin genauso vor wie das französische Pendant dazu. "Das beulemans, oder "französische Brüsslerisch", hat sich nach dem populären Theaterstück "Le Mariage de mademoiselle Beulemans" 1910 ausgebreitet. Dabei handelt es sich um ein Französisch, das Wörter aus dem flämischen Brüsselerisch entlehnt und mit einem lokalen Akzent versieht, der ziemlich exotisch in Ohren von Menschen klingt, die nicht aus Brüssel kommen." (Seite 69)
Weil Brüssel als Hauptstadt nun einmal auch einen wichtigen Bezug zum ganzen Land hat, findet im Buch auch immer wieder belgische Landeskunde statt - fast wie nebenbei. Gekonnt fasst die Autorin dabei verschiedene Epochen der Geschichte zusammen, geht auf die Problematik zwischen Flamen und Wallonen ein und vergisst auch nicht, das deutschsprachige Belgien dem Leser etwas nahezubringen.
Am Ende der Romanhandlung nach gut 100 Seiten folgen noch eine Liste von Wörtern aus dem lokalen Brüsseler Sprachgebrauch, zwei Seiten mit bemerkenswerten und teilweise überraschenden Details zu Brüssel und Belgien, fünf Vorschläge für Spaziergänge durch verschiedene Viertel der Stadt sowie Tipps und Hinweise, wie und wo man mehr erfahren kann über die Stadt und ihre Kinder.
Wenn die Protagonistin des Romans Brüssel nicht wirklich zu lieben scheint, gelingt der Autorin Daphné Tamage mit diesem Stadtführer-Roman eine großartige Liebeserklärung an Brüssel, von der man sich als Leser schnell und gerne verzaubern lässt.
Daphné Tamage, Bruxelles, 160 Seiten, Verlag L’arbre qui marche, 2025, 13,90 Euro.
Kay Wagner

