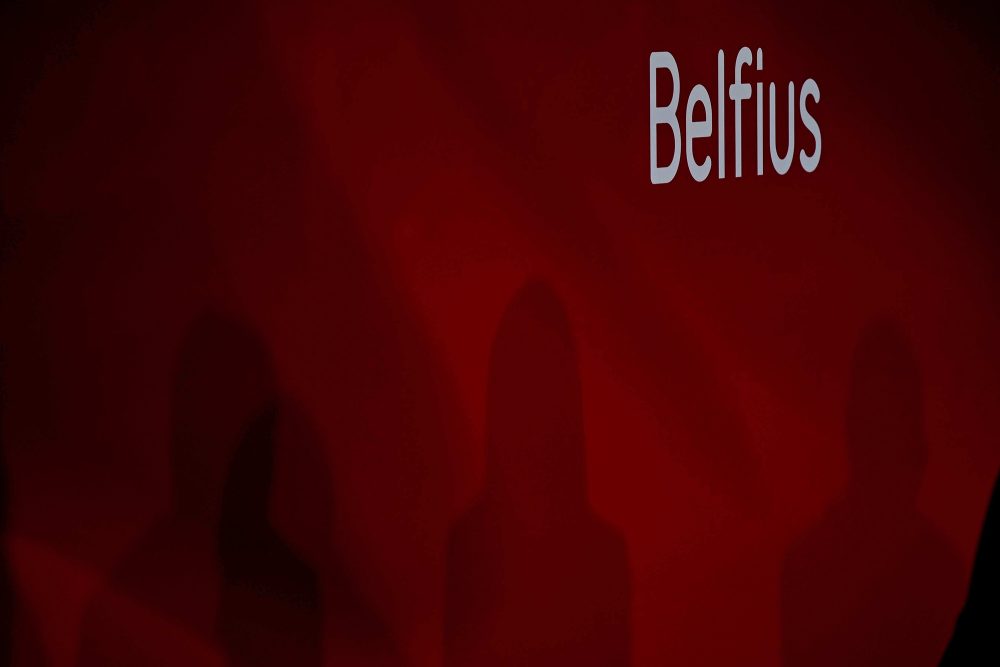"Die Belfius-Bank bereitet eine Teilprivatisierung vor", titeln De Tijd und Le Soir. "Die Teilprivatisierung ist angestoßen, aber ohne einen Börsengang", präzisiert La Libre Belgique. Belfius ist ja derzeit zu 100 Prozent in staatlicher Hand. Finanzminister Jan Jambon hat die Bank jetzt aber schriftlich dazu angehalten, eine Teilprivatisierung vorzubereiten mit dem Ziel, 20 Prozent des Kapitals für externe Investoren zu öffnen. Die Koalition muss die Entscheidung allerdings noch besiegeln. Beobachter gehen aber davon aus, dass das tatsächlich auch passieren wird, denn die Föderalregierung braucht bekanntlich Geld für die nötige Haushaltssanierung.
"Es wurde aber auch Zeit", lobt die Wirtschaftszeitung L'Echo die Entscheidung in ihrem Leitartikel. Seit 2011 gehört die Belfius-Bank dem Staat, genau gesagt seit der Rettung der einstigen Dexia. Am Ende wird es also fast 15 Jahre gedauert haben, bis sich das Geldhaus wieder zumindest teilweise auf eigene Beine stellen kann. Kleine Klammer: Die Rettung der Bank ist inzwischen bezahlt. Belfius hat in den letzten Jahren dem Staat mehr als vier Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet, also die Summe, die damals auf den Tisch gelegt werden musste. In anderen Ländern wurden Banken, die im Zuge der Finanzkrise verstaatlicht werden mussten, aber längst wieder privatisiert. Bei Belfius war das also überfällig. Für den Staat kann das zu einer lohnenden Operation werden: Der Buchwert der Bank beläuft sich inzwischen auf über zwölf Milliarden Euro. Doch auch Belfius kann hier nur gewinnen: Ein neuer Partner kann dabei helfen, die Bank auch international besser zu positionieren.
Der Staat ist kein Banker
"Doch für welchen Partner soll man sich entscheiden?", fragt sich La Libre Belgique. Es gibt da zwei Schulen: Entweder man optiert für einen blinden Passagier oder für einen Schatten-Steuermann. Der blinde Passagier, das wäre sozusagen ein stiller Teilhaber, der einfach auf einem vom Staat gelenkten Dampfer mitfährt. Das allerdings ist eher unwahrscheinlich, denn welcher private Investor würde sich auf so etwas einlassen, zumindest ohne eine wirkliche Gegenleistung? Wahrscheinlicher ist, dass man sich am Ende für den Schatten-Steuermann entscheidet. Das wäre also ein Partner, dem man realistische Chancen einräumt, dass er irgendwann auch in Belgien Fuß fassen kann. Das Risiko hielte sich in Grenzen, denn der Staat will schließlich auch in Zukunft auf üppige Dividenden zählen können. Unabhängig davon, welche Richtung man am Ende einschlägt, sollte der Staat dabei nie vergessen, dass der Verkauf des Tafelsilbers nie dazu dienen sollte, einfach nur punktuell Löcher zu stopfen. Das Geld sollte vielmehr in die Zukunft investiert werden.
"Aber warum soll es am Ende nur ein Partner sein?", fragt sich De Tijd. "Warum bereitet man nicht gleich einen Börsengang vor?". Klar muss der Staat die Sicherheit und die Stabilität des Finanzsystems garantieren. Ein Banker ist er allerdings nicht, das gehört nicht zu seinen Kernaufgaben. Deswegen spricht nichts dagegen, die Belfius-Bank einfach nur loszulassen. Die Brüsseler Börse würde wohl zu einem neuen, frischen Player nicht Nein sagen. Und die Börse ist zudem der beste Weg, um jedem Belgier die Möglichkeit zu geben, sich einen Teil des Kuchens zu sichern und Miteigner zu werden. Eine mögliche Übernahme durch einen ausländischen Akteur kann man verhindern, indem der Staat einfach nur eine Sperrminorität behält.
Ein vorprogrammierter Clash
Apropos Haushaltssanierung: Der Herbst könnte politisch doch ziemlich heiß werden, glaubt Le Soir. Die Zahlen sprechen für sich: Die wallonische Region wird bis zu 250 Millionen Euro finden müssen, die französische Gemeinschaft sogar 300 Millionen. Ganz zu schweigen vom Föderalstaat, der schnellstmöglich vier Milliarden auftreiben muss. Und dann dasselbe nochmal im kommenden Jahr. Bei solchen Summen kann man sich an den fünf Fingern abzählen, dass das für erhebliche Verwerfungen sorgen wird: Auf der einen Seite sehen wir entschlossene Koalitionen, die ebenso demonstrativ wie disruptiv mit der Vergangenheit brechen und die vor allem durch Entschlossenheit glänzen wollen. Auf der anderen Seite die – im frankophonen Landesteil – geschlossene Linke: Sozialisten, Marxisten und Grüne, die sich mitunter in ihrer Kritik an der Sparpolitik gegenseitig übertreffen wollen und damit noch hochschaukeln. Der Clash ist geradezu vorprogrammiert.
Egozentrische Unternehmer
"Aber was können eigentlich Milliardäre für das Land tun?", fragt sich leicht ketzerisch De Standaard. Europa steht im Augenblick in mehrfacher Hinsicht an einem Scheideweg. Angesichts klammer Kassen und steigender Verteidigungsausgaben schielt der Alte Kontinent immer häufiger auf die USA, wo man offensichtlich schneller Dollars verdienen kann, während es in der EU zu viele Regeln gibt, zu viel Bürokratie und gleichzeitig zu wenig Innovation, zu wenig Risikokapital, kurz und knapp: zu wenig Wachstum. Die politische Diskussion dreht sich denn auch häufig um die Frage, was ein Land oder was Europa tun kann, um das Kapital zu mobilisieren, um dem Geld den Weg zu ebnen. Manchmal sollte man diese Frage aber auch mal umdrehen. Der flämische Unternehmerverband Voka wettert gerade wieder gegen die Kapitalertragssteuer, gegen die Lohnindexbindung und gegen die "Lawine an Regeln". Zugleich werden aber mehr staatliche Unterstützung, also Zuschüsse für Unternehmen gefordert. Das ist eine doch sehr einseitige Sicht, und mit Blick auf die anstehenden, extrem schwierigen Haushaltsberatungen ist das sogar regelrecht empörend.
Roger Pint