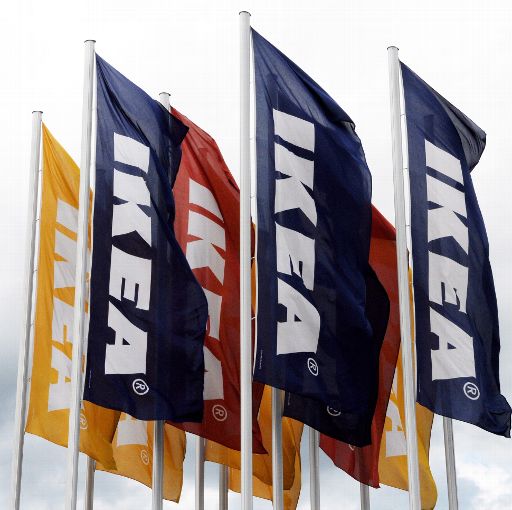Die schwedische Möbelkette Ikea hat die Zwangsarbeit politischer DDR-Häftlinge für das Unternehmen bedauert. "Der Einsatz von politischen Gefangenen in der Produktion war und ist völlig unakzeptabel", sagte der Geschäftsführer von Ikea Deutschland, Peter Betzel, am Freitag bei der Vorstellung einer Studie in Berlin. Spätestens seit 1981 wusste demnach das Unternehmen von dieser Möglichkeit.
"Ich möchte mein tiefstes Bedauern zum Ausdruck bringen", sagte Betzel. Das Unternehmen habe versucht, den Einsatz von politischen Gefangenen zu unterbinden. Heute sei klar, dass diese Maßnahmen nicht wirkungsvoll genug gewesen seien. Damals habe das Unternehmen noch kein umfassendes Kontrollsystem gehabt.
Ab 1980 hatte Ikea laut Studie eine Repräsentanz in Ost-Berlin, um die Ex- und Importe zu koordinieren. Es gab demnach mit mindestens neun Außenhandelsbetrieben Lieferverträge. Mindestens 66 Betriebe hatten demnach einen direkten Bezug zu Ikea. In Waldheim (Sachsen) seien beispielsweise Ikea-Sofas hergestellt worden, in Naumburg (Sachsen-Anhalt) Beschläge und Rollen. Nach Angaben des SED-Forschungsverbundes an der FU Berlin produzierten politische Häftlinge für den Westen beispielsweise in Bautzen auch Kühlschränke und Waschmaschinen oder im Frauengefängnis Hoheneck Bettwäsche.
Opferverbände hatten seit Monaten Aufklärung verlangt. Zunächst hatte das Unternehmen der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft eine Absage erteilt, sich dann aber nach Beschwerden und Unmut korrigiert. Am Freitag war das Echo geteilt. Einige Betroffene zeigten sich enttäuscht. Der Bericht soll aus "datenschutzrechtlichen Gründen" nur in Teilen öffentlich werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hatte die Studie erstellt.
Von Jutta Schütz, dpa - Bild: Mauritz Antin, epa